6. Februar 2018 Digitalisierung ERP
Um die Verteilung der Unternehmensressourcen im Blick zu behalten, ist für kleine und mittelständische Unternehmen der Einsatz eines ERP-Systems (Enterprise Ressource Planning) wichtiger denn je. Die Auswahl eines ERP-Systems fällt jedoch nicht leicht. Der Markt bietet von der komplexen Mammutlösung bis hin zur modularisierten und branchenspezifischen Lösung ein breites Angebot. In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, was Sie als mittelständisches Unternehmen bei der Auswahl eines ERP-Systems bedenken sollten und warum es nicht unbedingt die ERP-Großlösung sein muss.
Entscheidend für erfolgreiche ERP-Projekte sind zunächst ein gutes Projektmanagement sowie eine sinnvolle Zusammenstellung des Projektteams. Dabei sollten Sie neben einem Kernteam je nach Projektphase auch Mitarbeiter aus den jeweiligen Fachabteilungen integrieren. Zudem gilt, je intensiver und präziser die Arbeit in den einzelnen Vorbereitungsphasen erfolgt, desto einfacher ist am Ende die Auswahl eines ERP-Systems und Anbieters.
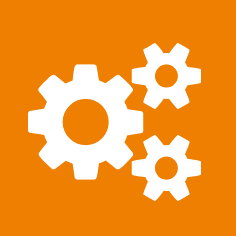 Die Einführung eines ERP-Systems ist nur sinnvoll, wenn das System in der Lage ist, alle wichtigen Prozesse des Unternehmens abzubilden. Aus diesem Grund steht an erster Stelle eine interne Bestandsaufnahme. Dabei sollten alle existierenden Geschäftsprozesse, notwendige Schnittstellen, die Organisationsstruktur und branchenspezifische Anforderungen definiert und dokumentiert werden.
Die Einführung eines ERP-Systems ist nur sinnvoll, wenn das System in der Lage ist, alle wichtigen Prozesse des Unternehmens abzubilden. Aus diesem Grund steht an erster Stelle eine interne Bestandsaufnahme. Dabei sollten alle existierenden Geschäftsprozesse, notwendige Schnittstellen, die Organisationsstruktur und branchenspezifische Anforderungen definiert und dokumentiert werden.
Weiterhin sollte darauf geachtet werden, dass das zukünftige ERP-System auch genutzt wird. Binden Sie daher in dieser Phase Mitarbeiter der entsprechenden Fachabteilungen ein. So sichern Sie die Benutzerakzeptanz und können die Bedürfnisse aller Abteilungen bei der Auswahl eines ERP-Systems berücksichtigen.
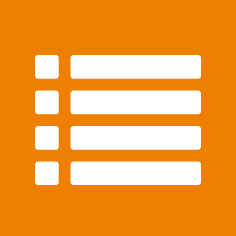 Im zweiten Schritt sollten alle Anforderungen für die Auswahl eines ERP-Systems in einem Katalog definiert und gewichtet werden. Dabei müssen insbesondere die Ergebnisse der Bestandsaufnahme berücksichtigt werden. Anhand des Anforderungskataloges kann so bereits eine Grobauswahl der recherchierten ERP-Systeme erfolgen.
Im zweiten Schritt sollten alle Anforderungen für die Auswahl eines ERP-Systems in einem Katalog definiert und gewichtet werden. Dabei müssen insbesondere die Ergebnisse der Bestandsaufnahme berücksichtigt werden. Anhand des Anforderungskataloges kann so bereits eine Grobauswahl der recherchierten ERP-Systeme erfolgen.
Wichtige Kriterien zur Auswahl eines ERP-Systems sind zum Beispiel:
 Im Anschluss werden die Anforderungen in einem Lastenheft bzw. Anforderungsprofil formuliert. Dieses dient als Ausschreibungsgrundlage für die Anbieter passender ERP-Systeme. In einem definierten Auswahlverfahren wird nach dem Preis oder der prozentualen Erfüllung der Anforderungen, ein entsprechender Anbieter mit dem vorgestellten System ausgewählt und beauftragt.
Im Anschluss werden die Anforderungen in einem Lastenheft bzw. Anforderungsprofil formuliert. Dieses dient als Ausschreibungsgrundlage für die Anbieter passender ERP-Systeme. In einem definierten Auswahlverfahren wird nach dem Preis oder der prozentualen Erfüllung der Anforderungen, ein entsprechender Anbieter mit dem vorgestellten System ausgewählt und beauftragt.
Zahlreiche Unternehmen entscheiden sich bei der Auswahl eines ERP-Systems für die umfangreichen Lösungen der Marktführer. Für Unternehmen mit einer komplexen Organisation oder Konzernstruktur kann dies durchaus sinnvoll sein.
Für mittelständische Unternehmen können spezielle Branchen- und Mittelstandslösungen jedoch die bessere Alternative sein. Denn wie bereits festgestellt, hängt die Effizienz des ERP-Systems nicht allein vom Können des Anbieters, sondern maßgeblich von der Passfähigkeit des Systems ab. Die Unterschiede lassen sich außerdem bezüglich Komplexität, Skalierbarkeit, Einführungszeit und Kosten erkennen.
ERP-Großlösungen umfassen zahlreiche Funktionen und Module, um komplexe Organisationen oder Konzernstrukturen abbilden zu können. Aus diesem Grund ist auch die Benutzeroberfläche dieser Systeme meist komplex, starr und wenig intuitiv. Anpassungen können zudem meist nur in Zusammenarbeit mit dem Hersteller oder einem Dienstleister erfolgen und sind kosten- und zeitintensiv.
Auch mittelständische Unternehmen benötigen zahlreiche Funktionen. Jedoch erfordert deren Dynamik eine größere Flexibilität. Mittelstandslösungen sind daher meist modular aufgebaut. Bei Bedarf können zusätzliche Funktionsgruppen (Module) hinzugefügt werden. Dies ist in der Regel auch ohne Einsatz des Herstellers möglich und kann mit Unterstützung der IT-Abteilung selbst durchgeführt werden. Im Ergebnis beinhaltet das ERP-System dann nur die Funktionen, die das Unternehmen auch tatsächlich benötigt. Somit kann eine durchgängig transparente Prozesskette im ERP-System abgebildet und die Anforderung an Flexibilität umgesetzt werden. Zusätzliche Sonderanforderungen können außerdem oft über die Integration von Fremdprodukten realisiert werden. Zudem bietet der Markt zahlreiche Branchenlösungen, die bereits auf die jeweiligen Unternehmen und deren Anforderungen abgestimmt sind.
Je nach Komplexität der Kundenanforderungen fällt auch bei Mittelstandslösungen ein entsprechend notwendiger Beratungsbedarf an. Hier empfiehlt sich oftmals ein Stufenkonzept in der Einführung, so dass nur Module und Funktionen beraten werden, die in den entsprechenden Abteilungen und Prozessen auch tatsächlich benötigt werden. In die weiteren Funktionalitäten wird erst bei Bedarf eingewiesen, so dass keine alten Schulungsinhalte wieder kostenpflichtig aufgefrischt werden müssen. Die hauseigene IT kann bei Installationen und Konfigurationen mit einbezogen werden und wichtige Teile davon bereits übernehmen. Somit muss nicht alles auf den Dienstleister verlagert werden. Je nach Technologie des ERP-Systems kann auf eine zwingende Neuanschaffung von Hardware verzichtet werden. Web- oder Cloud-basierte Systeme z. B. benötigen heutzutage nur noch einen Browser als Applikationsebene und halten somit die Kosten der Applikationshardware gering.
Wenn die Zusammenarbeit zwischen Kunde und Dienstleister gut strukturiert umgesetzt wird, ist das ERP-System in der Regel in einem überschaubaren Zeitraum eingeführt. Folgekosten entstehen dann noch mit Abschluss des Wartungsvertrages. Hier sind die Inhalte und Leistungen der ausschlaggebende Aspekt und nicht zwingend nur die Höhe des Wartungssatzes.
Mit dem Download der Datei „Grundaufbau Lastenheft“ erhalten Sie eine Orientierung zum möglichen Vorgehen bei der Erstellung eines Lastenheftes.
Desk Sharing ist ein Arbeitsplatzkonzept, bei dem Mitarbeitende keinen fest zugewiesenen Schreibtisch haben, sondern die Arbeitsplätze flexibel und nach Bedarf teilen. Es ist Teil der Bemühungen vieler Unternehmen, ihre Arbeitsumgebungen agiler, effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Der Blogbeitrag zeigt auf, wie eine IT-Lösungen diese Bestrebungen unterstützt.
Die Entwicklung von Produkten, Maschinen und Anlagen findet unter immer größerem Zeitdruck statt. Die Realität in vielen Fällen: Entwicklung, Produktion und Vertrieb arbeiten am gleichen Produkt, aber auf einer unterschiedlichen Informationsbasis. Mehr denn je ist eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und somit durchgängige digitale Daten notwendig, diese gelingt nur auf einer gemeinsamen Basis für die Informationen.
Viele Fertigungsunternehmen arbeiten im Engineering oder bei der Fertigung ihrer Erzeugnisse mit externen Partnern zusammen. Ob Fremdfertigung oder -konstruktion, Angebotsanfragen oder interne/externe Projektzusammenarbeit - die digitale Verwaltung der Produktdaten und das zentrale Datenmanagement spielen dabei eine entscheidende Rolle. Wir zeigen, wie Unternehmen mit einfachen Werkzeugen durch einen sicheren und ortsunabhängigen Zugriff auf Projektdaten ihren Geschäftsbetrieb sichern und damit verbundene Herausforderungen bewältigen, um zukünftig mehr Effizienz und Wettbewerbsvorteile zu schaffen.
Gut zu wissen, dass man bei der Wahl eines Systems auch ein Lastenheft formulieren kann. Wir brauchen ein neues System für unser Labor und denken an LIMS. Mit Ihren Tipps fällt die Entscheidung viel einfacher.